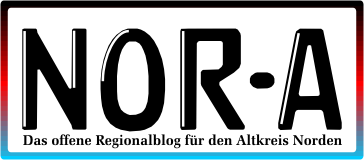Kulturinfarkt im Altkreis Norden?
(Norden) Im Onlinelexikon Wikipedia heißt es, Länder und Kommunen würden jede Theaterkarte mit durchschittlich 95,74 Euro subventionieren. Da fragt sich jeder, der mit den Namen Wagner, Frisch und Strauß erstmal Pizza und Jeans verbindet, ob man mit dem Geld nicht besser Krippenplätze schaffen oder Schlaglöcher schließen könnte. Warum soll der Malocher mit seinen Steuern dem Oberstudienrat den Opernplatz finanzieren, während er selbst seine Zerstreuung in Großraumdiskos und anderen profitablen Spaßfabriken findet?
Die Debatte um Kultursubventionen ist so alt wie die Scheidung von E und U. Neu ist, dass sie von Geförderten selbst angestoßen wird. Dieter Haselbach, Armin Klein, Pius Knüsel und Stephan Opitz – allesamt aus öffentlichen Mitteln bezahlte Kulturfunktionäre – beklagten im Frühjahr medienwirksam: „Der Kulturinfarkt. Von allem zu viel und überall das Gleiche“, so der Titel ihrer Streitschrift. Unter dem „Kultur für alle“ ufere das Angebot aus und leere die kargen Fördertöpfe. Die Lösung sei, so die Autoren, die Hälfte aller Kultureinrichtungen zu schließen und die Gelder auf die übrigen Theater und Museen zu verteilen, die auf Kommerzialisierung eingeschworen werden. Kunsthochschulen müssten marktfähige Produktionszentren werden, denn Kulturindustrie „ist Herstellung und Vertrieb von ästhetischen Erlebnissen in Warenform mit dem Willen zum Erfolg.“
Damit, so die postwendende Entgegnung aus dem deutschsprachigen Kulturbetrieb, würden sich die Autoren zu Verbündeten der Kulturverächter machen. Handelt es sich bloß um eine Luxusdebatte, die zum Beispiel ins hochverschuldete Berlin passt, das sich vier Opernhäuser leistet?

Kann sich Norden in Zeiten knapper Kassen zwei Teemuseen leisten, die noch dazu keinen Kandiswurf weit entfernt von einander sind? (Foto: ts)
Gerhard Hess, Intendant der Landesbühne Niedersachsen Nord, sieht sein Haus von der Diskussion nicht betroffen, im Gegenteil: Er weiß Publikum und die Politik parteiübergreifend hinter der Landesbühne, dem einzigen Theaterbetrieb für 700.000 Einwohner im Nordwesten. Man schwimme nicht in Steuergelder. „Die Finanzierung ist nur darum vorerst gesichert, weil die Kommunen wiederholt eingesprungen sind, nachdem das Land Niedersachsen seine jährlichen Zuwendungen auf 2,9 Mio. Euro gekürzt hat.“ Hess verweist auf das Staatstheater Hannover, das mit über 50 Mio. Euro pro Jahr vom Land getragen wird. „Die Stadt Hannover spart sich damit Kulturausgaben, die Kommunen wie Norden oder Esens nie aufbringen könnten. Wenn also über die Kosten diskutiert wird, ohne die Kultur nun einmal nicht zu haben ist, dann doch bitte darüber, wie ungleich sie die Kommunen belasten.“ An einer Verteilungsdebatte, in der ein Theater gegen das andere ausgespielt wird, möchte Hess jedoch nicht teilnehmen. Lieber greift er die Forderung auf, Kultureinrichtungen müssten sich als Unternehmen aufstellen: „Um ein Theater zu betreiben, braucht man Ressourcen wie Schauspieler, Bühnenbildner. Wenn man die hat, muss man sie auch nutzen. Es macht also betriebswirtschaftlich gar keinen Sinn, das Angebot zu verknappen.“
In der „Kulturinfarkt“-Debatte gehe es auch weniger um die Quantität, sondern um die Qualität des Kulturangebots, und daran kann und muss weiter gearbeitet werden, so Dr. Frank Schmidt, wissenschaftlicher Direktor der Kunsthalle Emden. Auch die Frage, ob jede Stadt ein eigenes Orchester oder Theater haben muss, könne man durchaus diskutieren: „Doch auf der ostfriesischen Halbinsel sehe ich diesen Verdrängungswettkampf weniger. Mit der Kunsthalle Wilhelmshaven und der Kunsthalle Emden decken lediglich zwei Häuser die Nachfrage nach Kunstmuseen ab.“
Die Kulturinstitutionen in der Region erfreuten sich mit ihren Besucherzahlen und ihrer Auslastung großer Nachfrage. Doch wofür dann noch Kultursubventionen? Hess verweist auf den pädagogischen Auftrag, den die Landesbühne trotz Querfinanzierung nicht kostendeckend erfüllen könnte. Dazu gehöre, nicht nur das legitime Unterhaltungsbedürfnis zu befriedigen, sondern auch schwierigere Stoffe auf die Bühne zu bringen. Auch Schmidt hält die Unterstützung der öffentlichen Hand aus dem gleichen Grund für sinnvoll: „Wo sonst sollten Kinder und Jugendliche mit Kunst, Literatur und Theater in Verbindung kommen als in den entsprechenden Häusern in ihrer Nähe?“
Norden dagegen hat seine zwei Teemuseen nicht etwa einem Subventionsunwesen zu verdanken. Vielmehr führten persönliche Zerwürfnisse dazu, dass die Familie Oswald-von Diepholz ihre Sammlung aus dem Teemuseum des Heimatvereins zurückzog und in eine eigene Ausstellung überführte. Die Stadt Norden engagiert sich sehr im „Ostfriesischen Teemuseum Norden“, das auch vom Kreis, Land und der EU Gelder erhält – allerdings nur, wenn eine Kofinanzierung aus Drittmitteln steht. Über „Kulturinfarkt“ kann der Leiter Dr. Matthias Stenger nur den Kopf schütteln: Das geforderte unternehmerische Denken, das den Besucher als Kunden begreift, sei im Museumsbereich längst üblich.
Auch zwei Häuser weiter im „Teemuseum / Sammlung Oswald-von Diepholz“ sieht man die „Kulturinfarkt“-Debatte gelassen. Die Ausstellung finanziert sich durch Mäzene und Spenden. Diese kommen aus aller Welt, wie auch die Exponate. So gibt es zwar zwei Teemuseen in Norden, aber nichts ist doppelt: Das Ostfriesische Teemuseum legt seinen Schwerpunkt auf Alltagskultur und Herstellung des Tees in Norden und anderswo, die Sammlung Oswald-von Diepholz dagegen auf gehobene Teekultur wie in der aktuellen Japan-Ausstellung. Man nehme einander nichts weg, betont Jürgen Christian Oswald-von Diepholz, im Gegenteil: Die Kombikarte beider Häuser gewährt Besuchern Einblicke sowohl in die ostfriesische als auch die höfische Teekultur. –
Was meinen Sie? Gibt es im Altkreis „zu viel vom Gleichen“? Muss das hiesige Kulturangebot sich mehr nach der Nachfrage richten? Schreiben Sie uns Ihre Meinung für die nächste Ausgabe per E-Mail, Brief oder Fax!